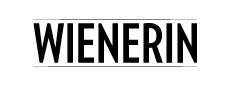Wie Körper und Seele aufeinander wirken
Von Gänsehaut und gebrochenen Herzen. Im Interview mit Margit Breuss.
© Unsplash/Omid Armin
Die Atemfrequenz beschleunigt sich, das Herz rast und unsere Muskeln spannen sich an: Wenn wir um unser Leben fürchten, konzentriert sich in unserem Körper alles auf das Wesentliche. Diese überlebenswichtige Fluchtreaktion funktionierte schon hervorragend, als Stress noch durch die Begegnung mit wilden Tieren verursacht wurde.
Heute, im 21. Jahrhundert, haben komplizierte Beziehungen, hohe Mietpreise und Zahnarztbesuche den Platz des gefürchteten Säbelzahntigers eingenommen. Und noch immer bilden Körper und Seele eine untrennbare Einheit. Den richtigen Umgang mit Stress kann man lernen. Wie? Das verrät uns Margit Breuss, Fachärztin für Psychatrie und Psychotherapeutische Medizin.
Wusstest du etwa, dass ein liebeskummergeplagtes Herz herzinfarktähnliche Symptome wie Atemnot, Brustschmerzen und Beklemmungsgefühle entwickeln kann?
Leid ohne Diagnose
Liebeskummer vergeht, ein Zahnarztbesuch ebenso – und mit ihnen meist auch die physischen Begleiterscheinungen. Doch in einigen Fällen werden sie chronisch und verursachen bei Betroffenen erhebliches Leid. Was folgt, ist eine schier endlose Odyssee von Arztpraxis zu Arztpraxis – doch die ersehnte Diagnose bleibt aus, denn Krankheitsherd ist partout keiner auszumachen.
Doch woher kommen das Herzrasen, der Tinnitus oder die permanenten Rückenschmerzen? Sind sie nur eingebildet? Warum sich spätestens jetzt ein Blick auf die Psyche lohnt und was das Ganze mit Gendermedizin zu tun hat, erklärt Margit Breuss im Interview.

Der Begriff Psychosomatik wird ja oft mit „eingebildeten Beschwerden“ übersetzt. Kann man das so sagen?
Margit Breuss: Nein. Diese Annahme ist falsch und schuld daran, dass viele leidende Menschen keine richtige Behandlung bekommen. Natürlich sind die Beschwerden echt und eigentlich kann sie auch jede:r nachvollziehen: Wenn wir nervös sind, haben wir Herzklopfen. Wenn wir Stress haben, bekommen wir Kopfschmerzen.
Diese Symptome haben wir alle schon einmal erlebt; und manche, wie Herzklopfen, lassen sich sogar objektiv messen. Reines Schmerzempfinden dagegen nicht, was den medizinischen Umgang damit auch so schwierig macht.
Wie kann man sich die Verbindung zwischen Psyche und Körper vorstellen?
Diese Verbindung passiert auf vielen verschiedenen Ebenen. Eine davon ist das vegetative Nervensystem, das unter anderem Blutdruck und Verdauung reguliert und aktiviert wird, wenn wir entspannt sind.
Dann gibt es die hormonelle Ebene, wenn unser Körper bei bestimmten Erlebnissen Stress- oder Glückshormone ausschüttet. Und auch die Ebene des Immunsystems spielt eine Rolle. Erlebte Stresssituationen beispielsweise lösen eine Reaktion in unserem Immunsystem aus, die auch noch Stunden und Tage später im Labor nachweisbar ist. Chronischer Stress kann das Immunsystem sogar dauerhaft verändern und durch einen erhöhten Cortisolspiegel teilweise unterdrücken.
Wann werden psychosomatische Beschwerden zum Problem?
Sobald sie nicht mehr von selbst weggehen oder so ausgeprägt sind, dass sie das tägliche Leben beeinträchtigen. Wir sprechen heute übrigens statt von psychosomatischen eher von funktionellen Körperbeschwerden, weil wir von einer Funktionsstörung ausgehen und diese Bezeichnung den Aspekt der „Einbildung“ außen vor lässt.
Die einen leiden an Magenschmerzen, die anderen an Tinnitus. Woran liegt es, wie sich somatoforme Beschwerden äußern?
Darauf gibt es keine einfache Antwort. Früher dachte man, dass die Symptome in Zusammenhang mit der Persönlichkeit stehen, aber davon ist man inzwischen abgekommen. Vielmehr werden heute Aspekte wie Erziehung und Sozialisierung berücksichtigt. Beispielsweise: Wie geht die eigene Familie und das Umfeld mit Schmerzen und Krankheiten um? Welche Vorerfahrungen haben die Person geprägt?
Manchmal hatte die eigene Mutter schon ähnliche Beschwerden, die sich auf die Tochter übertragen. Da kommen viele Faktoren zusammen, die sich nicht so einfach aufschlüsseln lassen. Generell leiden Menschen, die in ihrer Kindheit Traumatisierungserfahrungen gemacht haben, häufiger an Krankheiten und insbesondere auch an funktionellen Körperbeschwerden.

Gibt es hier Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Ja, Frauen sind häufiger von funktionellen Körperbeschwerden betroffen als Männer.
Warum?
Dafür gibt es verschiedene Theorien. Eine Erklärung könnte sein, dass Frauen eher gewillt sind, über ihre Empfindungen – nicht nur emotionale, sondern auch körperliche – zu sprechen.
Gemäß der veralteten Redensart „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“ wird dagegen vom männlichen Rollenbild erwartet, Schmerzen eher für sich zu behalten. Wie schon vorhin erwähnt, spielen Traumatisierungen ebenfalls eine große Rolle. Und Frauen werden in ihrer Kindheit nun einmal öfter missbraucht als Männer.
Auch Frauen in den Wechseljahren entwickeln häufig funktionelle Körperbeschwerden, oft aus einem Überforderungszustand heraus – wenn sie sich neben den hormonellen Schwankungen auch noch mit beruflichen Veränderungen, dem Auszug der Kinder und dem Verlust der Elternrolle beschäftigen müssen.
Können psychosomatische Beschwerden auch gefährlich werden?
Nicht unbedingt akut. Man stirbt nicht an Herzbeschwerden, die sich anfühlen wie ein Herzinfarkt. Langfristig können sie aber durchaus gefährlich werden. Wenn Menschen beispielsweise das Haus nicht mehr verlassen, was neben sozialer Isolation auch einen Muskelabbau zur Folge haben kann.
Oder wenn sich eine Patientin aufgrund von Schmerzen immer in einer angespannten Schonhaltung bewegt, die sich wiederum auf die Gelenke und letztlich den ganzen Körper auswirken kann.
Es heißt, Stress ist so gefährlich wie Zigaretten und kann sogar Krebs auslösen. Was sagen Sie dazu?
Mein Kollege Christian Schubert, der im Bereich der Psychoneuroimmunologie forscht, würde dazu sagen: Wer behauptet, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen Stress und Krebs, hat zu wenig geforscht.
In großen Forschungsarbeiten werden stressige Lebensereignisse wie Scheidung, Umzug oder Arbeitsverlust oft nicht adäquat bewertet, weil die individuelle Bedeutung und die persönliche Vulnerabilität nicht berücksichtigt
werden. Dafür ist der Aufwand sehr groß. Aber ja, ich gehe davon aus, dass es hier durchaus Zusammenhänge gibt.

Wie hoch sind die Heilungschancen bei somatoformen Störungen?
Wir gehen davon aus, dass etwa fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung von funktionellen Körperbeschwerden betroffen sind. Davon sind etwa zwei Drittel relativ leicht zu überwinden, sofern man die Auslöser identifiziert und entsprechende Gegenmaßnahmen trifft. Nur bei einem Drittel sind die Verläufe schwer.
Zum Beispiel, wenn jemand schon als Kind Missbrauch erlebt hat und bereits im Kindesalter Symptome entwickelt, die dann bis ins Erwachsenendasein andauern. Je länger die Beschwerden andauern, desto schwieriger sind sie zu behandeln. Bei einem Teil der Menschen gehen die Symptome wahrscheinlich auch nicht mehr weg. Hier geht es darum, einen Umgang zu finden, der trotzdem eine gute Lebensqualität ermöglicht.
Auf der einen Seite werden psychische Aspekte in der Schulmedizin immer noch stiefmütterlich behandelt, auf der anderen Seite wird zum Beispiel ein Herzinfarkt bei Frauen seltener erkannt, weil ihre Symptome oft auf die Psyche geschoben werden. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dass hier viele Faktoren zusammenkommen. Einerseits sind somatoforme Beschwerden ja oft sehr unspezifisch, andererseits ist bekannt, dass Frauen öfter unter funktionellen Körperbeschwerden leiden. Und das wiederum führt dazu, dass Frauen oft selbst denken, dass ihre Beschwerden psychisch bedingt sind.
Auf der anderen Seite leben wir in einem Medizinsystem, das über Jahrhunderte hinweg von Männern für Männer gemacht wurde. Sogar die Versuchstiere sind im Regelfall immer noch männlich. Daraus ist ein Prototyp vom männlichen Patienten mit männlichen Beschwerden entstanden, der den weiblichen Körper einfach nicht oder nur bedingt berücksichtigt.
Braucht es hier in der Schulmedizin mehr Interdisziplinarität?
Absolut. Ein ideales Szenario für mich wäre, dass der oder die medizinische Erstansprechpartner:in die möglichen psychischen Aspekte schon mitdenkt. Die erfolgreiche Behandlung von Rückenschmerzen erfordert ja auch Physiotherapie als begleitende Maßnahme. Natürlich muss man bei anhaltenden körperlichen Beschwerden zunächst organische Ursachen abklären. Aber wichtig wäre, dass es nicht ein Entweder-oder ist, sondern eine Zusammenarbeit beider Disziplinen.

Wohin können sich Betroffene wenden, wenn keine körperliche Ursache für ihr Leiden gefunden wird?
In der Theorie ist der:die Hausärzt:in die richtige Anlaufstelle, der:die gegebenenfalls eine entsprechende Überweisung schreibt. In der Praxis müssen allerdings viele Patient:innen die Suche nach dem:der
richtigen Therapeut:in selbst in die Hand nehmen.
Im Grunde gibt es Psychosomatik-Spezialist:innen in sämtlichen Fachrichtungen – Psychiatrie, Psychotherapie oder auch klinische Psychologie. In der Therapie gehen wir gemeinsam den möglichen Ursachen für die Beschwerden auf den Grund und entwickeln individualisierte Strategien, mit denen der:die Patient:in den Auslösern gezielt entgegenwirken kann.
Das könnte dich auch interessieren:
Kennst du Triggerpunkte? Sie sind oft Grund für Dauerschmerzen
MEHR ÜBER DIE AUTORIN:

Andrea Lichtfuss ist Chefredakteurin der TIROLERIN und für die Ressorts Beauty, Style und Gesundheit zuständig. Sie mag Parfums, Dackel und Fantasyromane. In ihrer Freizeit findet man sie vor der X-Box, beim Pub-Quiz oder im Drogeriemarkt.
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
7 Min.
Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz darf kein Tabu sein
Psychische Krisenerfahrungen und der Weg zurück in die Arbeit – wie man Betroffene dabei unterstützen kann.
Psychische Gesundheit betrifft uns alle – trotzdem wird darüber am Arbeitsplatz noch viel zu selten gesprochen. Wie Menschen mit psychischen Krisenerfahrungen den Weg zurück in die Arbeitswelt schaffen und was Arbeitgebende tun können, um sie dabei zu unterstützen. Stress, Überforderung, ständige Erreichbarkeit: Immer mehr Menschen geraten im Arbeitsleben an ihre psychischen Grenzen. Laut WHO ist … Continued
7 Min.
Lifestyle
3 Min.
Hörtipps für graue Tage
Podcasts, Songs & Soundscapes für ruhige Momente im Winter
Wenn der Himmel grau bleibt und die Tage sich endlos anfühlen, braucht es manchmal keinen Tapetenwechsel – sondern den richtigen Sound. Musik, Stimmen und leise Geräusche können genau das sein, was uns durch den Winter trägt: sanft, entschleunigend, ehrlich. Hier kommen meine Hörtipps für Tage, an denen man langsamer wird: Podcasts, die sich wie Gespräche … Continued
3 Min.
Mehr zu Gesundheit