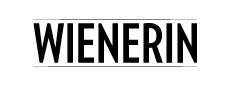Rassismus: Unter die Haut
Rassistisches Denken ist nach wie vor tief in der Gesellschaft verankert, wenn auch oftmals im Unsichtbaren. Wie es gelingt, dies aufzubrechen.
© Shutterstock
Es ist die ständige Frage nach der Herkunft, auch wenn sie überhaupt keine Rolle spielt. Es sind schwarz angemalte Sternsinger. Oder es sind Wohnungen, die nicht an Personen mit bestimmten Nachnamen vergeben werden. Und es sind Polizeikontrollen, die bei Schwarzen Menschen fast doppelt so oft stattfinden wie bei weißen. Rassismus ist allgegenwärtig und doch oft unsichtbar, insbesondere für die imaginierte weiße Mehrheitsgesellschaft.
Bewusstmachung.
„Ich meins ja nicht böse“, „Das war schon immer so“ oder „Für mich sind sowieso alle Menschen gleich“ wird
häufig entgegnet, sobald man Menschen mit rassistischen Denk- oder Verhaltensweisen konfrontiert. Rassismus wird häufig nur dann als solcher ernst genommen, wenn körperliche Übergriffe gegen Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion stattgefunden haben. Dabei wäre gerade auch die Bewusstmachung von Alltagsrassismus so wichtig, um die alten Denkmuster abzulegen, betont auch Miriam Hill – Leiterin von ARA (Antirassismus-Arbeit) Tirol, einer Anlauf-, Service- und Monitoringstelle für rassismus- und diskriminierungskritische Arbeit. Wir haben die Expertin zum Gespräch gebeten.

Sind wir alle rassistisch sozialisiert?
Miriam Hill: Ja. Wir alle haben rassistisches Wissen schon als Kinder erlernt, etwa durch Kinderlieder, Reime, Spiele, Filme oder sogar Bezeichnungen von Süßspeisen. Dieses Wissen hat sich natürlich festgesetzt, und es ist schwierig, es wieder zu „verlernen“. Erst seit ein paar Jahren gibt es vermehrt Bemühungen und Ansätze, wie man Kinder rassismussensibel erziehen kann. Aber hier spielt natürlich nicht nur die Erziehung eine Rolle, sondern auch andere Kontexte, in denen sich das Kind bewegt – Schule, Sportverein und so weiter.
Was ist Alltagsrassismus und wie macht er sich bemerkbar?
Alltagsrassismus hängt vor allem davon ab, wie man gesellschaftlich positioniert ist. Wenn man als Einheimischer gelesen wird – etwa aufgrund des Aussehens oder der Sprache , dann macht man andere Erfahrungen mit Rassismus, als wenn man als nicht dazugehörig betrachtet wird. Als potenziell betroffene Person muss ich aber immer damit rechnen, Rassismuserfahrungen zu machen. Das können offene Beschimpfungen sein, aber auch scheinbar banale Dinge: Zum Beispiel, wenn ich mich im Bus auf einen freien Platz setze und die neben mir sitzende Person aufsteht – nicht weil sie aussteigen möchte, sondern weil sie nicht neben mir sitzen möchte, weil ich Schwarz bin. Wenn ich bei Behördengängen aufgrund meiner Herkunft unfreundlich behandelt oder ganz ignoriert werde. Auch bei der Wohnungs- und Jobsuche schwingt der Herkunftskontext immer mit. Wir registrieren viele Fälle wo Nachbar:innen Menschen mit Migrationsgeschichte offen beschimpfen. Hier geht es vor allem um die Konstruktion von „Wir“ und „die Anderen“.

Blackfacing im Fasching, Sternsinger oder Mohrenbräu: Wie weit darf Tradition gehen?
Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Als Antirassismusstelle geht es uns in erster Linie um die Gleichbehandlung aller Menschen. Was wir tun, ist hinzuschauen und zu sensibilisieren. Statt „Wie weit darf Tradition gehen“ würde ich mich in konkreten Fällen eher fragen: Braucht es das? Ist das Schwarzanmalen bei den Sternsingern beispielsweise wirklich so wichtig, um die Figur darzustellen? Oder finden wir im Jahr 2023 auch andere Möglichkeiten der Darstellung und der Repräsentation? Weil es geht ja nicht nur darum, dass man etwas abbildet. Es geht auch um gesellschaftliche Macht- und Ungleichheitsverhältnisse. Und es geht letztlich auch um die Menschenwürde.
Unser Angebot an Akteur:innen ist immer, in Dialog zu treten und darüber zu sprechen, dass bestimmte Verhaltensweisen Menschen verletzen können, für die Rassismuserfahrungen immer noch Teil ihres alltäglichen Lebens sind. Im Frühjahr wurde uns ein Vorfall am Thaurer Fasching gemeldet. wo Teilnehmer:innen eines Umzugwagens schwarz angemalt, mit einem Lendenschurz bekleidet, in Ketten gelegt und teilweise sogar ausgepeitscht wurden. Es waren verstörende Bilder, die aus unserer Sicht menschenunwürdig waren. Und obwohl der Impuls nicht von der ARA Tirol, sondern von den zahlreichen Besucher:innen kam die den Vorfall gemeldet haben, sahen die Veranstalter:innen keinen Anlass zur Veränderung – eben aufgrund der „Tradition“. Und dann fragt man sich im Umkehrschluss: Was haben schwarze Sklaven mit einem Tiroler Traditionsverein zu tun? Welche traditionelle, kritische, satirische, künstlerische oder gar humorvolle Auseinandersetzung soll da stattgefunden haben? Und wenn ja, aus welcher Perspektive und mit welchem Ziel?
Wie steht es hier um die gesetzliche Grundlage?
Es ist eine Gratwanderung, wann etwas wirklich gegen das Gesetz verstößt. „Satire darf alles“, wird hier häufig argumentiert, auch von öffentlichen Vertreter:innen. Ich denke, dass in Bezug auf den Schutz vor Rassismus mehr getan werden muss, weil die derzeitige Situation vieles zulässt, was eigentlich ein Unding ist und viel Schaden anrichtet.

„Für mich gibt es keinen Rassismus, denn in meinem Weltbild sind alle Menschen gleich.“ Inwiefern ist diese Aussage problematisch?
Sie ist problematisch, weil sie gesellschaftliche Realitäten ausblendet. Denn de facto haben nicht alle Menschen in unserer Gesellschaft die gleichen Rechte und werden gleich behandelt. Menschen werden aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Staatsbürgerschaft, ihrer Sprache und ihres Aussehens diskriminiert, sowohl am Arbeitsmarkt als auch im privaten Kontext. Aussagen wie „Für mich sind alle Menschen gleich“ negieren diese Ungleichheitsverhältnisse. Sie negieren die Erfahrung der Frau, die Angst hat, nach Hause zu gehen, weil sie immer wieder von ihrer Nachbarin rassistisch beschimpft wird. Oder die Erfahrung geflüchteter Menschen, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, obwohl sie schon eine ganze Weile hier leben.
Die amerikanische Feministin und Lyrikerin Pat Parker hat das gut auf den Punkt gebracht: „Vergiss, dass ich Schwarz bin. Vergiss nie, dass ich Schwarz bin.‟ Also: Behandle mich gleich wie alle anderen, aber bedenke auch, dass ich strukturell anders behandelt werde. Es geht nicht nur um die individuelle Ebene, sondern auch um die strukturelle.
Wie kann man sich den Arbeitsalltag in der Antirassismus-Arbeit vorstellen?
Wir wenden uns an alle Menschen, vorrangig an jene, die selbst Rassismuserfahrungen gemacht haben. Das können direkt Betroffene sein, Zeug:innen, die auf offener Straße einen Vorfall beobachtet haben und das melden möchten. Eltern, deren Kind Rassismuserfahrungen gemacht hat, oder auch Erlebnisse im beruflichen Kontext. Darüber hinaus unterstützen wir Vereine, Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit rassismuskritischen Workshops, Vorträgen oder Einzelberatungen. Wenn nötig, vermitteln wir auch an die Gleichbehandlungsanwaltschaft.
Wie gelingt es, rassistische Denkmuster & Rassismus bei sich selbst aufzudecken und aufzulösen?
Zunächst muss man erkennen, dass Rassismus nicht nur körperliche Übergriffe beinhaltet, sondern auch sehr subtil und für Außenstehende kaum sichtbar sein kann. Rassismus findet auf mehreren Ebenen statt – auf individueller, institutioneller, struktureller und diskursiver Ebene. Auch die Medien spielen eine wichtige Rolle.
Wer immer die gleiche Zeitung liest, wird ständig mit den gleichen Botschaften konfrontiert. Je öfter wir lesen, dass ein:e Straftäter:in Migrationsgeschichte aufweist, desto eher setzt sich diese Assoziation in unserem Kopf fest. Aber die Veränderung muss grundsätzlich immer bei einem selbst stattfinden. Dafür braucht es zuallererst das Bewusstsein, dass man rassistische Bilder schon von Kind auf übernommen hat. Die Bewusstwerdung ist ein essenzieller erster Schritt. Denn nur dadurch kann man auch eine entsprechende Haltung zu dem Thema entwickeln. Und es braucht sicherlich auch den Willen, die Rassismen, die jede:r von uns in sich trägt, und die Bilder, die man sonst immer als real erachtet hat, infrage zu stellen – und vielleicht zu erkennen, dass sie falsch sind. Das ist allerdings ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet.
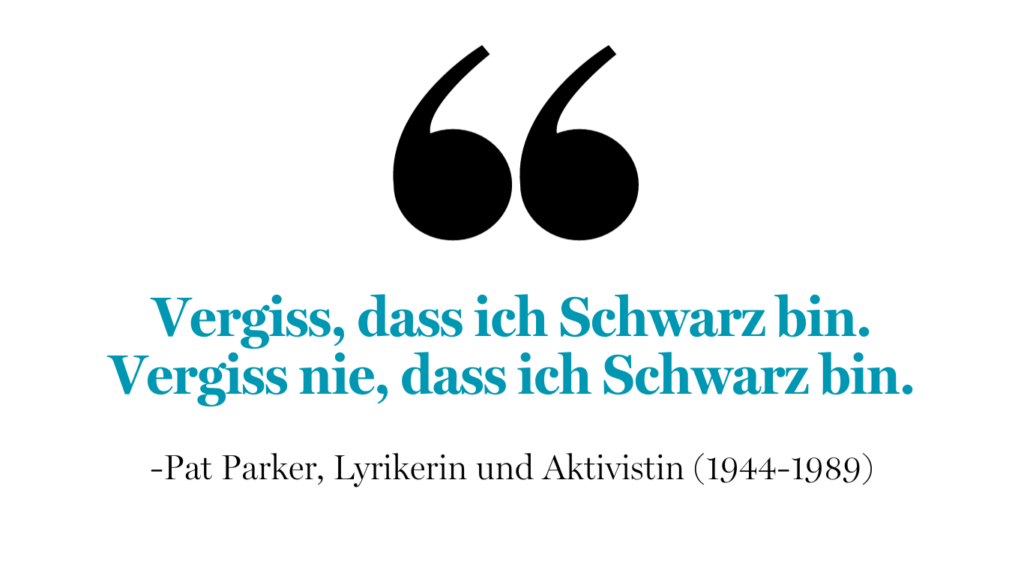
Was kann jede:r von uns tun, um die Antirassismus-Arbeit zu unterstützen?
Zivilcourage finde ich einen wichtigen Punkt. Dass wir wach sind für Rassismen, die in unserem Umfeld stattfinden – sei es, wenn es den Nachbarn betrifft oder eine Mitschülerin. Dass wir hellhörig werden und nicht weg-, sondern hinschauen, dass wir der Person zu Hilfe kommen oder den Vorfall ansprechen- Wer rassistische Vorfälle beobachtet, kann bei uns – auch über die Website – anonym Meldungen erstatten. Diese Information könnte man auch an den Freundes- und Familienkreis weitergeben. Wir dokumentieren jeden Fall und bieten bei Bedarf auch Einzelfallberatungen an. Gerade in Unternehmen oder öffentlichen Stellen erachte ich die Mehrsprachigkeit als wichtigen Punkt, der in einer globalisierten Welt nötig ist, um die Menschen, die herkommen, auch wirklich abzuholen. Mehrsprachige Folder oder Informationsmaterial zum Beispiel können schon eine große Hilfe sein.
Diskussionen über Rassismus können zermürbend sein, besonders in der eigenen Familie. Haben Sie einen Tipp für die rassismuskritische Gesprächsführung im privaten Umfeld?
Ganz spontan würde ich sagen: Wissen und Fakten. Und diese Fakten gibt es. Wenn es beispielsweise um Menschen mit Migrationsgeschichte geht, kann es sinnvoll sein, die Realität anhand von konkreten Zahlen abzubilden und so gewisse Vorannahmen zu entkräften. Gegen Argumente wie „Die wollen ja eh nix arbeiten‟ könnte man beispielsweise halten, wie hoch der Arbeitslosenanteil unter jenen Menschen tatsächlich ist; neben der Tatsache, dass die Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen mit zahlreichen Hürden verbunden ist, wodurch Betroffene häufig erst nach mehreren Jahren tatsächlichen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Generell sollte man aber offen sein, auch wenn das Gegenüber eine ganz andere Auffassung hat. Wenn ich mit rassistischen Empörungen konfrontiert werde, lasse ich die Person erstmal sprechen und versuche dann, das Gesagte zu entkräften. Das ist meist ein Prozess, aber wenn man sich auf den Dialog einlässt und einen langen Atem hat, kann man durchaus ein Umdenken hervorrufen.
Weitere Artikel zu diesem Thema
People
6 Min.
Vom Dorftratsch auf die große Bühne
Michael Steiger über Heimatgefühl, Humor als Überlebensstrategie und den Mut, eigene Wege zu gehen.
Endlich hat der Manfred der Marlene einen Heiratsantrag gemacht! Und über 17.000 Follower haben dies zwischen den Weihnachtsfeiertagen auf Social Media mitverfolgt. Wer Michael Steiger (@michidersteiger) bereits kennt, weiß, wovon ich spreche. Wer nicht, der sollte dieses Interview umso genauer lesen. Wir treffen den 26-Jährigen an einem frühen Nachmittag in einem Café in der Eisenstädter … Continued
6 Min.
Mehr zu People