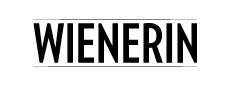Warum toxische Frauenfreundschaften wie in “White Lotus” keine Seltenheit sind
Beste Feindinnen
In der dritten Staffel von „The White Lotus“ kann man die toxischen Freundschaftstrukturen von Kate (Leslie Bibb), Jaclyn (Michelle Monaghan) und Laurie (Carrie Coon) mitverfolgen. Zu sehen auf Sky. © HBO 2025/ Sky Austria
Toxische Dynamiken in Frauenfreundschaften sind keine Seltenheit. Was dahinter steckt, wie man aus den Strukturen ausbrechen kann und wann eine Trennung unvermeidbar ist.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Meeresrauschen, Palmen, Sonnenschein und drei Frauen, die sich seit ihrer Schulzeit kennen, sich seit Jahrzehnten beste Freundinnen nennen und nach all den Jahren gemeinsam Urlaub in Thailand machen.
Damals unzertrennlich, haben sie sich in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Die eine ist Anwältin in New York und alleinerziehende Mutter, die andere verheiratet in Texas und die dritte weltberühmte Schauspielerin. Was als Idylle beginnt, mündet schon am ersten Abend in Lästereien untereinander, sobald eine der drei nicht mehr am Tisch sitzt. Mitverfolgen kann man diese toxische Frauenfreundschaft in der aktuellen dritten Staffel der Hit-Serie „The White Lotus“. In den sozialen Medien zeigen sich viele Streamer:innen von dem Plot begeistert, sie erkennen sich und Erlebtes in der ungeschönten, realistischen Situation wieder. Woher kommt das?
Wie kommt es zu toxischen Frauenfreundschaften?
„Kann man überhaupt befreundet sein, wenn man keinen gemeinsamen Alltag hat?“, fragt daraufhin Psychotherapeutin Teresa Dicks auf TikTok in einem Video. Und sie stellt fest: Neid und Missgunst können auch nach jahrelanger Freundschaft toxische Umfelder generieren und begünstigen.
Gehässige Kommentare unter Freundinnen, toxische Frauenfreundschaften, Stutenbissigkeit und Lästereien können jedoch nicht nur dadurch entstehen, wie Dicks im Gespräch mit uns festhält: „Wenn eine Person immer die dominante Rolle übernimmt, Entscheidungen trifft oder sich überlegen fühlt, kann das eine Ursache sein. Oder wenn Vergleichsdruck herrscht. Besonders in Zeiten sozialer Medien kann es zu einem ständigen Vergleichen kommen, was zu Minderwertigkeitsgefühlen oder Konkurrenzdenken führt.” Weiters nennt sie emotionale Abhängigkeit, wenn eine Seite stark auf die Bestätigung der anderen angewiesen ist und die Freundschaft als essenzielle Quelle für Selbstwert fungiert.
Dr. Laura Stoiber, Psychologin aus Wien, fügt hinzu: “Toxische Dynamiken entstehen oft durch soziale Prägung, persönliche Unsicherheiten oder ungelöste emotionale Konflikte. Auch gesellschaftlicher Druck, etwa durch Konkurrenzdenken oder Perfektionismus, kann diese Dynamiken fördern. Das sehe ich in Männer- und Frauenfreundschaften, wobei bei Frauenfreundschaften oft mehr und intensivere Emotionen im Spiel sind.”
Im Interview mit uns erklärt sie, dass man im Allgemeinen eine Freundschaft dann als toxisch bezeichnet, wenn die Beziehung langfristig mehr Schaden als Nutzen bringt: “Sie ist durch negative Dynamiken, emotionale Erschöpfung und oft auch ein Ungleichgewicht in Geben und Nehmen geprägt.” Toxisch möchte sie hier gar als psychisch ungesund definieren.
Wie kann man negative Dynamiken erkennen?
Stoiber nennt als Anzeichen toxischer Frauenfreundschaften beispielsweise ständige Kritik oder Abwertung, Manipulation und Schuldzuweisungen, Konkurrenzdenken statt Unterstützung, emotionale Erpressung, und ein Gefühl der Erschöpfung nach dem Kontakt. Daneben nennt Dicks auch noch Eifersucht und Kontrolle als eindeutiges Zeichen.
“Wenn eine Freundschaft mehr Stress als Freude bringt, ist das oft ein Zeichen, dass sie aus dem Gleichgewicht geraten ist”, zieht Dicks ihr Fazit. Merke man solche Strukturen, raten die Expertinnen in sich zu gehen und zu evaluieren, wie man sich nach gemeinsamen Treffen fühle. “Toxische Freundschaften können zu Stress, Angstzuständen, Selbstzweifeln und sogar depressiven Verstimmungen führen. Langfristig können sie das
Selbstwertgefühl erheblich beeinträchtigen und soziale Isolation begünstigen”, hält Stoiber fest. Daher herrscht Handlungsbedarf.
Wann sollte man eine Freundschaft beenden?
Im Fall der Freundinnen in “The White Lotus” fragt man sich nach jeder Folge immer mehr, wieso diese Frauen sich als Freundinnen sehen. Sie scheinen kaum Gemeinsamkeiten zu haben, entwickelten unterschiedliche Werte im Laufe ihres Lebens und es herrscht ein starkes Machtgefälle, da die reiche Hollywood-Schauspielerin für die Reise finanziell aufkommt. Man kommt nicht umhin sich zu fragen: Sollten sie besser keine Freundinnen mehr
sein und getrennte Wege gehen?
Vergangenheit allein reicht immerhin nicht als Anker der Freundschaft, wie auch Dicks anmerkt. Stoiber rät zu einer Trennung einer Freundschaft, sobald die Freundschaft zunehmend als Belastung wahrgenommen wird, man emotionale Erschöpfung sowie Stress wahrnimmt und eigene Grenzen mehrmals überschritten wurden. Als elementares Anzeichen für eine Trennung nennt sie eine fehlende Einsicht und Veränderungsbereitschaft.
„Manche Freundschaften haben eine Ablaufzeit. Wenn sich die Werte oder Lebenswege zu sehr auseinanderentwickelt haben und immer wieder Konflikte entstehen, kann es gesünder sein, loszulassen oder die Intensität der Freundschaft zu reduzieren. Manche Freundschaften können sich transformieren – andere verlaufen sich, wenn sie mehr Belastung als Bereicherung sind. Und das ist völlig in Ordnung”, so Dicks ergänzend.
Entscheidet man sich für einen Kontaktabbruch, kann das anfangs ebenfalls belastend sein – eben klassischer Trennungsschmerz. “Akzeptiere deine Gefühle und sprich mit Vertrauenspersonen. Nimm deine Gefühle ernst und erkenne, dass du nicht allein damit bist. Denke daran: Eine Freundschaft sollte Kraft geben, nicht nehmen”, rät Stoiber zum Umgang mit dem Abschied.
Kann man toxische Dynamiken ändern?
Muss es denn sofort ein Ende der Freundschaft sein oder kann man auch toxische Dynamiken zu guten Beziehungen ändern? “Ja, aber nur, wenn beide Seiten bereit sind, an der Beziehung zu arbeiten”, stellt Stoiber klar. “Falls noch genug Wertschätzung vorhanden ist, kann ein ehrliches Gespräch über die unausgesprochenen Spannungen helfen. Wichtig ist, Vorwürfe zu vermeiden und stattdessen Ich-Botschaften zu verwenden: ‘Ich
fühle mich manchmal klein gemacht, wenn du das sagst.’”, erklärt Dicks.
Gemeinsame Reflexion und Veränderungsbereitschaft seien essenziell, sind sich die Expertinnen sicher. Auch externe Unterstützung durch Therapie oder Coaching wird als Hilfsmittel genannt. Vor toxischen Dynamiken könne man sich zudem künftig schützen, indem man Beziehungen stets reflektiere, so Stoiber abschließend. So
könne man eigene Trigger und Muster definieren und Achtsamkeit gegenüber emotionaler Manipulation entwickeln. Als Ziel könne man sich setzen, Grenzen bewusst zu ziehen, diese zu kommunizieren und schlussendlich auch durchzuhalten.
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
1 Min.
Salted Caramel Launch von Dulcesserie
Kreative Drinks, verführerische Sweet Tables, aromatischer Spezialitätenkaffee und pikante kanarische Akzente
Ein Hauch von Luxus. Ein Spiel aus Süße und Salz. Und ein Abend, der mehr war als ein Launch.Beim exklusiven Salted-Caramel-Event verwandelte Markus Hufnagl, besser bekannt als DULCESSERIE, den Schauraum von Barameter 8 in eine Bühne für zeitgemäßen Genuss mit Attitüde. Gemeinsam mit Acrea Design Studio, die den Launch mitorganisierte, entstand ein kuratiertes Erlebnis zwischen Design, Kulinarik und Lifestyle. … Continued
1 Min.
Lifestyle
7 Min.
Geschmäcker von morgen: Das sind die Genuss-Trends 2026
Was die Genuss-Trends 2026 über unseren Lifestyle, unsere Werte und unsere Esskultur verraten – und wie ein Innsbrucker Dinnerclub Kulinarik als verbindendes Erlebnis inszeniert.
Matcha-Latte, Kimchi, Baked-Feta-Pasta und High-Protein-Produkte: Food-Trends gehen heute in schwindelerregender Geschwindigkeit um die Welt. Manche verschwinden ebenso schnell wie sie gekommen sind, andere setzen sich dauerhaft durch – und hinter den meisten scheinbar austauschbaren Hypes verbergen sich tiefgreifende Veränderungen. Sie zeigen, wie wir essen, mit wem wir essen und welche Erwartungen wir an kulinarische Erlebnisse … Continued
7 Min.
Mehr zu Lifestyle