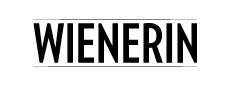Smart bis in den Sarg: Im Gespräch mit einer Gedächtnisforscherin
Gedächtnisforscherin Barbara Plagg erklärt, wie wir unser Gehirn stärken, Vergesslichkeit vorbeugen und geistig fit bleiben können.
© Unsplash/ Milad Fakurian
Am Ende sterben wir zwar sowieso, aber vorher haben wir mehr vom Leben, wenn wir geistig fit bleiben, sagt die Gedächtnisforscherin Barbara Plagg. Und dafür kann man etwas tun!
Wo sind schon wie der die Schlüssel? Was wollten wir gerade noch tun? Und wie hieß gleich noch die neue Kollegin? Kleine Erinnerungslücken gehören zum Alltag – und sorgen bei vielen dennoch für Beunruhigung. Doch was sagt unsere Vergesslichkeit wirklich über die Leistung unseres Gehirns aus? Und was können wir tun, um unser Gedächtnis fit zu halten?
Die Südtiroler Wissenschaftlerin Dr. Barbara Plagg kennt sich mit dem menschlichen Erinnerungsvermögen bestens aus. In ihrem neuen Buch räumt sie mit gängigen Gedächtnismythen auf und zeigt: Wie gut unser Gehirn funktioniert, hängt stark davon ab, wie wir leben – und davon, dass wir früh damit anfangen, es zu pflegen.
Frau Plagg, wann haben Sie zuletzt Ihren Autoschlüssel verlegt?
Barbara Plagg: Warten Sie, ich sag’s Ihnen gleich, ich muss nur zuerst noch schnell mein Handy suchen … (lacht) Was ich damit sagen will: Ich verlege mehrmals am Tag irgendwas.

Und besteht Grund zur Sorge, wenn das bei uns auch so ist?
Nein, denn das liegt an drei Dingen: Erstens ist unser Gedächtnis keine fixe Festplatte, sondern ein empfindliches Tierchen, das darauf reagiert, wie gut wir geschlafen haben, wie gestresst wir sind, ob wir uns genug bewegt und gesund ernährt haben – und ein müdes, überlastetes Gehirn ist schlichtschusseliger als ein ausgeschlafenes, entspanntes und gut ernährtes.
Zweitens ist Aufmerksamkeit der Schlüssel im Erinnerungsprozess und sie tanzt im Alltag oft auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig. Wenn unser Gedächtnis mit den Informationen jongliert, dass noch Hafermilch fehlt, der Projektentwurf morgen fertig sein muss und wir nebenbei das Kind aus der Kita holen, ist es nicht verwunderlich, dass wir keine Ahnung mehr haben, wo wir den Autoschlüssel hingeworfen haben.
Und drittens ist unser Gedächtnis ziemlich effizient und sortiert konsequent aus, was weder wichtig noch emotional aufgeladen ist: Dass die Nachbarin wieder nach Rimini gefahren ist, fällt da eben mal durchs Raster. Problematisch wird es, wenn man Dinge plötzlich nicht mehr kann, die man immer konnte, wenn der Überblick im Alltag verloren geht oder das Vergessen über einen längeren Zeitraum anhält. Dann sollte man diese Symptome fachärztlich abklären lassen.
Wenn unser Gedächtnis kein reines Archiv für Fakten ist, was leistet unser Gedächtnis wirklich?
Kurz gesagt: Alles. Es sorgt dafür, dass wir uns morgens die Jeans über die Beine statt über den Kopf ziehen und aus der Kaffeetasse und nicht aus der Blumenvase trinken. Das Gedächtnis ist kein Fotoalbum, das man ab und zu mal durchblättert, um zu schauen, was früher mal war, sondern unser inneres Navigationssystem für die Gegenwart. Es bewirkt, dass wir wissen, was wir tun und warum wir es tun. Erinnern heißt: klarkommen im Jetzt. Deswegen ist es absolut essenziell, dass wir unser Gedächtnis gut pflegen!
Was läuft da im Hintergrund unseres Gedächtnisses alles ab?
Selbst wenn Sie denken, Sie denken nicht, dann denken Sie nur, Sie denken nicht – denn das Gehirn ist permanent am Sortieren, Verknüpfen und Bewerten. Sogar während Sie schlafen und davon träumen, in Unterwäsche auf einem Einhorn durch Innsbruck zu reiten, arbeiten Ihre Hippocampi und schieben relevante Erfahrungen des Tages ins Langzeitgedächtnis.
Apropos nicht daran denken: Viele Inhalte sind so gut abgespeichert, dass wir sie nicht mehr bewusst abrufen müssen, etwa das Radfahren oder das Zehn-Finger-Schreiben. Wenn das mal nicht eine großartige Leistung unseres Gedächtnisses ist! Wir sollten uns mindestens genauso oft, wie wir uns über Schusseligkeiten ärgern, darüber freuen, dass das meiste wie geschmiert läuft!
Inwieweit beeinflusst der Lebensstil unsere Gedächtnisleistung?
Wie wir leben, so denken wir auch. Haben wir zu wenig geschlafen, sind wir nach Studienlage rund 40 Prozent „dümmer“, sprich langsamer beim Problemlösen, Erinnern und Mitdenken. Sind wir gestresst, können wir schlechter neue Erinnerungen bilden. Gute Ernährung schlägt hingegen mit einer besseren Gedächtnisleistung zu Buche: In einer Studie waren ältere Menschen, die sich nach der sogenannten MIND-Diät ernährten – vor allem ungesättigte Fettsäuren, wenig Fleisch, viel Gemüse und Obst – im Schnitt 7,5 Jahre „jünger im Kopf“ als Menschen, die sich schlecht ernährten.
Bewegung ist sowieso ein absoluter Brainbooster: Sie pumpt Sauerstoff ins Oberstübchen, schüttet Wachstumsfaktoren aus und reduziert Entzündungen. Und was soziale Kontakte angeht, konnte schon oft gezeigt werden, dass Menschen, die ehrenamtliche Arbeit leisten und sich mit Freund:innen treffen, das Gehirn besser in Schuss halten. All das beeinflusst nicht nur unmittelbar unsere Tagesverfassung, sondern senkt auch langfristig das Risiko für Demenzerkrankungen. Das wird immer noch gewaltig unterschätzt, weil viele Menschen glauben, dass die Erkrankungen ausschließlich genetisch bedingt sind.

Sind sie nicht?
Bei den allermeisten Menschen ist die Genetik die Souffleuse im Theaterstück, die einiges einflüstert, aber nicht die ganze Aufführung bestimmt. Die gute Nachricht ist: Ausschließlich genetisch bedingte Demenzerkrankungen sind sehr selten. In den aller meisten Fällen spielen neben einer genetischen Prädisposition vor allem auch Lebensstil, Vorerkrankungen, Umweltfaktoren und manchmal auch schlicht Zufall eine Rolle. Konkret heißt das: Die Gene geben den Rahmen vor, aber wir haben mit unseren täglichen Lebensstilentscheidungen einen Spielraum. Und das ist doch eigentlich beruhigend.
Verändert auch die digitale Welt mit ihrer ständigen Verfügbarkeit von Informationen unsere Gedächtnisleistung?
Leider ja. Wussten wir früher noch die Telefonnummern unserer besten Freund:innen auswendig, kennen wir heute höchstens den PIN unserer Bankomatkarte. Die ständige Verfügbarkeit von Informationen verändert unser Gedächtnis: Wir speichern weniger was, sondern eher wo wir es finden. Man könnte auch schlicht sagen: Wir werden faul. Und weil das Gehirn nach dem Use-it-or-lose-it-Prinzip funktioniert und verschleißt, wenn es nicht benutzt wird, kann kognitive Faulheit langfristig zum Problem werden. Während sich beim Lernen Nervenzellen verbinden, werden diese Nervenzellverbindungen beim Vergessen wieder abgebaut. Es gilt: Je mehr wir von diesen Verbindungen haben, desto stabiler bleibt unser Gedächtnis. Das nennen wir „kognitive Reserve“ und diese Reserve hilft uns, trotz Alter, Nervenzellschwund und Krankheiten länger geistig fit zu bleiben. Wenn wir aber immer weniger stabile Verbindungen aufbauen, weil wir das Denken an ChatGPT auslagern, dann haben wir wenig kognitive Reserve. Und das ist nicht gut.
Was also hilft unser Gedächtnis fit zu halten?
Es müssen nicht immer Sudoku oder Gedächtnis-Apps sein – der Alltag bietet unzählige Möglichkeiten, die grauen Zellen zu trainieren. Nützlich ist alles, was uns aus der geistigen Komfortzone herausholt. Denn Routine ist zwar effizient und energiesparend, macht uns aber nicht schlauer. Wer jeden Tag denselben Ablauf hat, ruft nur ab, was er bereits eingespeichert hat. Nehmen wir doch mal eine andere Route zur Arbeit, merken wir uns die Einkaufsliste im Kopf und lassen wir uns auf ein Gespräch mit jemandem ein, dessen Namen wir uns bewusst zu merken versuchen. Wichtig ist, die Neugier zu behalten. Wer fragt, denkt. Und wer denkt, lernt. Egal, ob es um den Namen der neuen Nachbarin oder um Käseherstellung geht – Hauptsache, das Hirn hat was zu tun.
Wann sollten wir idealerweise damit anfangen?
Am besten vorgestern, aber heute geht auch noch gut. Und zur Not auch noch nächste Woche. Die gute Nachricht ist: Es ist nie zu spät für Prävention, egal wie alt man ist und wie viele Vorerkrankungen man hat. Unser Gehirn reagiert zeitlebens auf unseren Lebensstil. Was man allerdings sagen muss: Blöderweise kümmern wir uns oft erst um unser Gedächtnis, wenn wir älter werden. Dabei müsste man das Gehirn von Anfang an fordern und fördern. Dazu muss man aber wissen, wie – und deshalb müsste es eigentlich eine bildungs- und gesundheitspolitische Priorität sein, dass man bereits Kindern ein gesundes Maß an Gesundheitskompetenz für dieses so wichtige Organ vermittelt.
Und was, wenn der innere Schweinehund mal wieder besonders laut wird, sobald es an die Umsetzung geht?
Wir wissen alle längst, dass wir uns bewegen und gesund ernähren sollten. Und tun es trotzdem nicht! Warum uns Verhaltensänderungen so schwerfallen, liegt an vier kleinen „Tierchen“ in uns: dem Gegenwartstierchen, dem Gewohnheitstierchen, dem Gewinnertierchen und dem Spaßvogel. Sie sind der Grund, warum wir auf der Couch liegenbleiben, anstatt die Laufschuhe anzuziehen – aber diese Tierchen lassen sich mit ein paar cleveren Tricks und ein bisschen Geduld überlisten. Und die lohnt sich, denn Studien zeigen: Nach durchschnittlich 66 Tagen kann aus einer neuen Handlung eine feste Gewohnheit werden. Klingt machbar, oder? Wer wissen möchte, wie man die Tierchen im eigenen Oberstübchen genau zähmt, kann das in meinem Buch nachlesen und dann direkt loslegen

10 TIPPS FÜR EIN SMARTES HIRN
- Aufmerksamkeit ist der Schlüssel: Was wir nicht bewusst wahrnehmen, kann auch nicht gespeichert werden.
- Wiederholen – aber mit Abstand: Regelmäßig abrufen ist effektiver als Pauken auf einen Schlag.
- Eselsbrücken bauen: Wer Merkstützen nutzt und schwierige Inhalte mit einfachen verbindet, macht sie leichter abrufbar.
- Mit Emotionen verknüpfen: Alles, was emotional eingefärbt ist, flutscht leichter ins Gedächtnis und bleibt länger erhalten.
- Mit Bildern und Geschichten arbeiten: Unser Gehirn liebt visuelle Reize und kann sie sich besser merken.
- In Bewegung lernen: Körperliche Aktivität fördert die Merkfähigkeit. Lieber ein Spaziermeeting als ein müdes Brainstorming im grauen Büro.
- Laut aussprechen oder aufschreiben: Aktiv verarbeiten verstärkt den Lerneffekt.
- Schlaf nicht unterschätzen: Gelerntes wird im Tiefschlaf gefestigt.
- Witziges bleibt besser hängen: Humor aktiviert emotionale Zentren – und die wirken wie Lernverstärker.
- Neugierig bleiben: Wer sich für etwas interessiert, lernt leichter!
Das könnte dich auch interessieren:
- Wie Körper und Seele aufeinander wirken
- Mental Load: Die unsichtbare Last
- Susanne Schmidt-Neubauer: Demenz kennt kein Alter
Mehr über die Autorin:

Leonie Werus betreut die Ressorts Genuss, Wohnen, Freizeit und Gesundheit. Sie ist ein echter Workhaholic und weiß es jede Minute gut für sich zu nutzen. Mit ihren Airfryer, liebevoll Fritti genannt, probiert sie gerne neue Rezepte und versucht nebenbei das TIROLERIN-Team zum Sport zu motivieren – meist leider vergeblich.
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
4 Min.
So prägt 2026 die Welt der Frauengesundheit
Weg von Tabus, Unsichtbarkeit und Symptombehandlung – hin zu ganzheitlichem Wohlbefinden über alle Lebensphasen hinweg
Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Körperliches Wohlbefinden, mentale Stärke, Ernährung, Bewegung und die Fähigkeit, mit dem eigenen Körper in Austausch zu treten: Dieses ganzheitliche Verständnis von Gesundheit spiegelt sich in einer Reihe aktueller Entwicklungen wider, die zeigen, wie wir Gesundheit selbstbestimmt, individuell und zukunftsorientiert leben. Den Zyklus verstehen Der weibliche Zyklus ist … Continued
4 Min.
Mehr zu Gesundheit