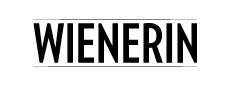© Shutterstock
Trauma hier, Trigger da. Begriffe aus der Psychotherapie prägen heute unseren Wortschatz. Warum wir lernen müssen, sorgsamer über psychische Gesundheit zu sprechen.
Es braucht oft nicht viel: ein schiefer Blick auf der Straße, negatives Feedback im Meeting oder das Date, das sich plötzlich nicht mehr meldet – unangenehme Erlebnisse, zweifellos. Aber ist das schon traumatisierend? Wer heute durch Social Media scrollt oder Gesprächen in der U-Bahn lauscht, gewinnt schnell den Eindruck, dass jede negative Erfahrung tiefe Spuren hinterlässt und wir in einer kollektiv traumatisierten Gesellschaft leben. Vokabular aus der Psychotherapie ist allgegenwärtig, in Memes, Reels und Alltagsgesprächen. Der narzisstische Ex, die toxische Freundin, das Gespräch, das einen „komplett triggert“. Man kennt’s.
Doch was steckt hinter der Veralltäglichung psychischer Diagnosen? Was bedeutet Trauma wirklich? Und: Ist der inflationäre Gebrauch therapeutischer Begriffe problematisch oder birgt er auch Chancen? Barbara Fereberger, Klinische- und Gesundheitspsychologin bei der Wiener Couch, ordnet ein.
Tatsächlich geben die Zahlen dem Gefühl recht. Laut dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) ist das Wort „Trauma“ in überregionalen Medien seit 1946 kontinuierlich häufiger aufgetaucht – mit einem besonders starken Anstieg in den letzten Jahren. Auch Barbara Fereberger, die sich in ihrer Praxis im siebten Bezirk seit 2015 auf Traumatherapie spezialisiert hat, bemerkt, dass es vermehrt zu einem inflationären Gebrauch des Wortes in der Alltagssprache kommt. „Trauma ist ein Begriff, der eine ernsthafte psychische Erschütterung beschreibt, aber in der Alltagssprache oft für Belastungen verwendet wird, die nicht in diese Kategorie fallen.“
Was ist ein Trauma?
Nicht jede belastende Erfahrung ist gleich traumatisierend. In der Psychologie werden traumatische Erfahrungen in zwei Hauptkategorien unterteilt: Schocktrauma und komplexe Traumata. „Eine bekannte Diagnose ist die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), die nach einem einmaligen, schweren Ereignis wie einem Unfall oder einem Kriegserlebnis entstehen kann“, erklärt Fereberger. „Man wird komplett aus der Bahn geworfen und das Leben danach fühlt sich nicht mehr so an wie davor.“
Bei der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (C-PTBS) hingegen handelt es sich um wiederholte traumatische Erfahrungen, oft im Bindungsbereich, etwa durch anhaltende Gewalt oder Beschämung in der Kindheit. „Solche schwierigen Kindheitssituationen können das Nervensystem so nachhaltig schädigen, dass es sehr schwierig ist, wieder herauszukommen“, betont die Psychologin. „Während Schocktraumata oft eine bessere Heilungschance haben, kann eine C-PTBS das Nervensystem so stark beeinträchtigen, dass jahrelange Therapie notwendig ist.“ Beide Formen können mit Symptomen wie Flashbacks, Schlafstörungen, emotionaler Abgestumpftheit oder Beziehungsproblemen einhergehen.
Die Macht der Sprache
Was früher tabuisiert wurde, findet heute mehr Aufmerksamkeit. Eine Entwicklung, die grundsätzlich positiv zu sehen ist. Doch laut der Wiener Psychologin und Traumatherapeutin werden Wörter aus der Therapiesprache zunehmend diagnostisch verwendet: „Menschen sagen schnell, sie seien ,traumatisiert‘ oder stellen andere Selbstdiagnosen, zum Beispiel, dass sie ADHS hätten, ohne die Schwere dieser Begriffe zu verstehen.“ Das sei problematisch, weil eine tatsächliche Traumafolgestörung eine gravierende Diagnose ist, die nach ernsthaften Erlebnissen gestellt wird.
Soziale Medien können ein Bewusstsein für psychische Belastungen schaffen.
Barbara Ferebeger, Gesundheitspsychologin und Traumatherapeutin
„Wenn der Begriff inflationär verwendet wird, verliert er an Bedeutung“, warnt sie. „Menschen, die wirklich traumatisiert sind, neigen dazu, darüber zu schweigen, denn Verdrängung ist oft Teil des Traumas.“ Gleichzeitig werde der Begriff in der Gesellschaft teils zu locker gebraucht, was das Verständnis für echte Traumata verwässert. Das könne für Betroffene belastend sein, denn wenn „traumatisiert“ als Alltagsfloskel genutzt wird, fühlen sich Menschen mit einer echten Traumafolgestörung möglicherweise nicht ernst genommen und ziehen sich noch mehr zurück.
Besonders brisant wird es, wenn Sprache nicht nur ungenau, sondern gezielt manipulativ eingesetzt wird. Im Englischen hat sich dafür bereits der Begriff „Weaponized Therapy Speak“ etabliert. Damit ist die Tendenz gemeint, therapeutische Begriffe strategisch zu verwenden – etwa um Kritik abzuwehren, Schuldzuweisungen zu tätigen oder zwischenmenschliche Konflikte zu instrumentalisieren. „Dass Sprache im Allgemeinen manipulativ genutzt werden kann, ist nichts Neues.
Neu ist aber, dass Begriffe aus der Therapiesprache als Ausreden oder zur Ausgrenzung genutzt und zum Beispiel in Konflikten verwendet werden, um jemanden abzulehnen oder zu diffamieren.“ Solche Deutungsmuster verschieben das eigentliche Anliegen – Verständnis und Unterstützung für psychisches Leiden – hin zu einem sprachlichen Machtmittel.
Fluch oder Segen?
Während vor noch nicht allzu langer Zeit über Trauma, Depression oder Angst geschwiegen wurde, gibt es heute Podcasts, TikToks und Info-Plattformen ohne Ende. Social Media hat zweifellos dazu beigetragen, dass psychische Gesundheit weitgehend enttabuisiert wurde. Besonders jüngere Generationen scheinen heute offener darüber zu sprechen.
Eine Sozialarbeiterin aus der Mobilen Jugendarbeit schildert uns ihre Beobachtungen: „Ich habe den Eindruck, dass Jugendliche heute einen größeren Wortschatz haben, um ihre psychische Gesundheit zu beschreiben. Es könnte ein Vorteil sein, dass Jugendliche Wörter, wie ,triggern‘, ,toxisch‘ und ,Trauma‘ kennen und damit ihre eigene Gefühlswelt und Beziehungen so eventuell besser einordnen und beschreiben können.“ Allerdings beobachtet sie auch, dass diese Begriffe manchmal in einem anderen Kontext genutzt werden, als es Fachpersonen tun würden, und es daher umso wichtiger sei, genau nachzufragen und auf Augenhöhe zu kommunizieren, um zu verstehen, was wirklich gemeint ist.
Barbara Fereberger bestätigt: „Junge Menschen werden sich durch Instagram, TikTok & Co. oft erstmals bewusst, dass sie belastende Erfahrungen gemacht haben. Das ist ein durchaus positiver Effekt. Soziale Medien können somit auch hilfreich sein, weil sie ein Bewusstsein für psychische Belastungen schaffen.“ Aber sie warnt davor, Selbstdiagnosen zu stellen: „Eine fundierte Diagnose kann nur eine Fachperson stellen und die Therapie sollte individuell angepasst sein.
Gerade in den Weiten des Internets ist ein kritischer Blick besonders wichtig. Denn mit der zunehmenden Enttabuisierung steigt auch das Angebot an zweifelhaften Online-Selbsthilfemethoden. „Gerade in sozialen Netzwerken verbreiten sich Fehlinformationen extrem schnell und es ist für Laien oft schwer, zwischen professionellem Rat und Halbwissen zu unterscheiden. Es gibt viele unseriöse Ratgeber und dubiose Coachings von vermeintlichen Expert:innen, die schnelle Heilung versprechen. Man sollte sich immer fragen: Hat diese Person eine fundierte Ausbildung? Ist ihre Methode wissenschaftlich anerkannt?“, rät sie.
Wer wirklich Hilfe sucht, sollte sich an ausgebildete Fachkräfte wenden – etwa an das Traumakompetenzzentrum der Wiener Couch. Dort gibt es seit drei Jahren eine von Barbara Fereberger gegründete Traumagruppe, die kostengünstige Gruppentherapie ermöglicht – ein Angebot, das im ambulanten Bereich selten ist und laut der Traumatherapeutin besonders wirkungsvoll sei, da soziale Unterstützung ein zentraler Faktor bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen sein kann.
Warum es klare Begriffe braucht
Wie kann man also psychische Gesundheit ernst nehmen, ohne Begriffe wie „Trauma“ zu entwerten? Für Barbara Fereberger ist die Antwort klar: „Wir müssen achtsam mit Sprache umgehen. Es ist wichtig, dass wir Worte bewusst wählen und uns fragen: Spreche ich wirklich von einem Trauma oder von einer negativen Erfahrung?“ Zugleich betont die Therapeutin, wie wichtig fundierte Aufklärung sei.
Viele Menschen unterschätzen, welche tiefgreifenden Auswirkungen eine echte posttraumatische Belastungsstörung auf das Leben haben kann. Trauma sei kein „cooler“ Ausdruck, den man leichtfertig verwenden sollte. In ihrer Praxis sehe sie immer wieder, wie viel Kraft und Ausdauer es brauche, um traumatische Erfahrungen zu verarbeiten. Heilung sei harte Arbeit und erfordere nicht nur Mitgefühl, sondern auch gezielte Hilfe.
Gerade in einer Zeit, in der die Welt von Krisen, Kriegen und Konflikten erschüttert wird, sind viele Menschen – oft unbemerkt – mit den Folgen traumatischer Erlebnisse konfrontiert. „Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir tagtäglich mit solchen Erfahrungen in Kontakt kommen, ohne es zu merken“, sagt die Expertin.
Deshalb sei es wichtig, dass wir als Gesellschaft nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern genauer hinsehen – besonders bei Menschen, die Flucht, Gewalt oder Ausgrenzung erlebt haben. „Das Thema wird politisch wie gesellschaftlich oft unter den Teppich gekehrt. Dabei wäre genau hier mehr Raum in der öffentlichen Diskussion dringend notwendig.“
DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN
- Fehlgeburt: “Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen können”
- Healthism: Gesundheitswahn oder Selbstfürsorge?
- Boomer vs Zoomer: Generation Z gewinnen und halten
MEHR ÜBER DIE REDAKTEURIN:

Als Redakteurin der WIENERIN erkundet Laura Altenhofer gerne die neuesten Hotspots der Stadt. Besonders angetan hat es ihr jedoch die vielfältige Musikszene Wiens. Ob intime Clubkonzerte oder große Festivalbühnen – man findet sie meist dort, wo die Musik spielt.
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
3 Min.
Vorab ausgezeichnet: Die Top 10 Weine der Weinmesse Innsbruck 2026
Qualität, die überzeugt – schon vor dem ersten Messetag.
Noch bevor die Weinmesse Innsbruck 2026 ihre Tore öffnet, rückt ein besonderes Highlight in den Fokus: die exklusive Blindverkostung der eingereichten Spitzenweine, die am 7. Februar 2026 stattgefunden hat. Ausgewählte Weine der ausstellenden Winzer:innen wurden dabei von einer hochkarätig besetzten Fachjury blind verkostet und objektiv bewertet. Die Jury setzte sich aus renommierten Vertreter:innen aus Sommellerie, Gastronomie, Hotellerie und Medien zusammen – … Continued
3 Min.
Lifestyle
3 Min.
Weinmesse Innsbruck 2026 – das Genusserlebnis des Jahres
Die Weinmesse Innsbruck 2026 lädt zum Genusserlebnis der Extraklasse
Vom 26. bis 28. Februar 2026 verwandelt sich die Messe Innsbruck bereits zum 24. Mal in einen Treffpunkt für alle, die Wein, Genuss und persönliche Begegnungen lieben. Die Weinmesse Innsbruck ist mehr als eine Messe – sie ist ein Fest für die Sinne. Rund 140 Aussteller:innen aus 7 Nationen präsentieren etwa 1.300 erlesene Weine, Schaumweine und … Continued
3 Min.
Mehr zu Lifestyle