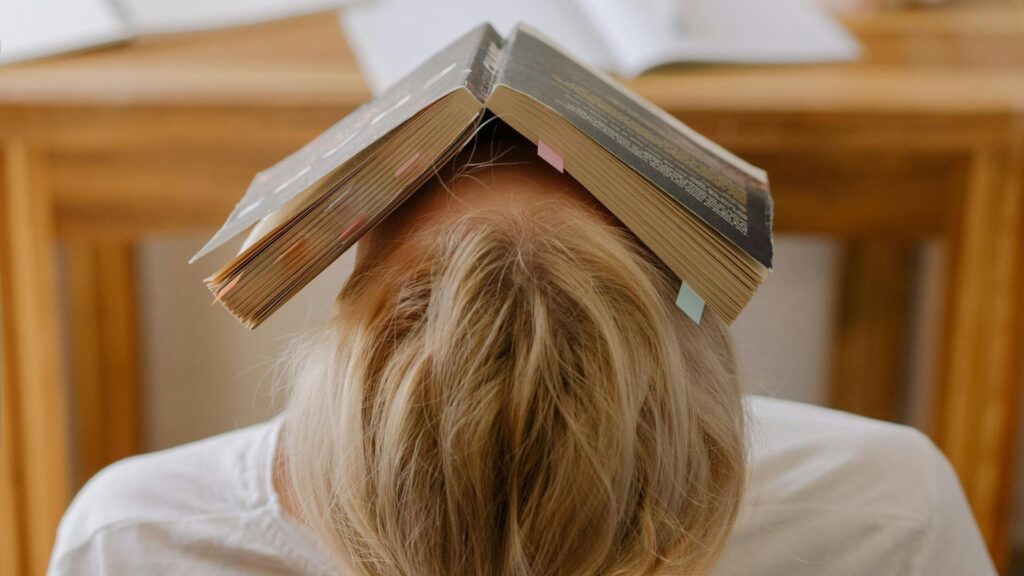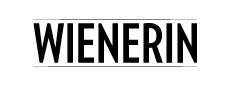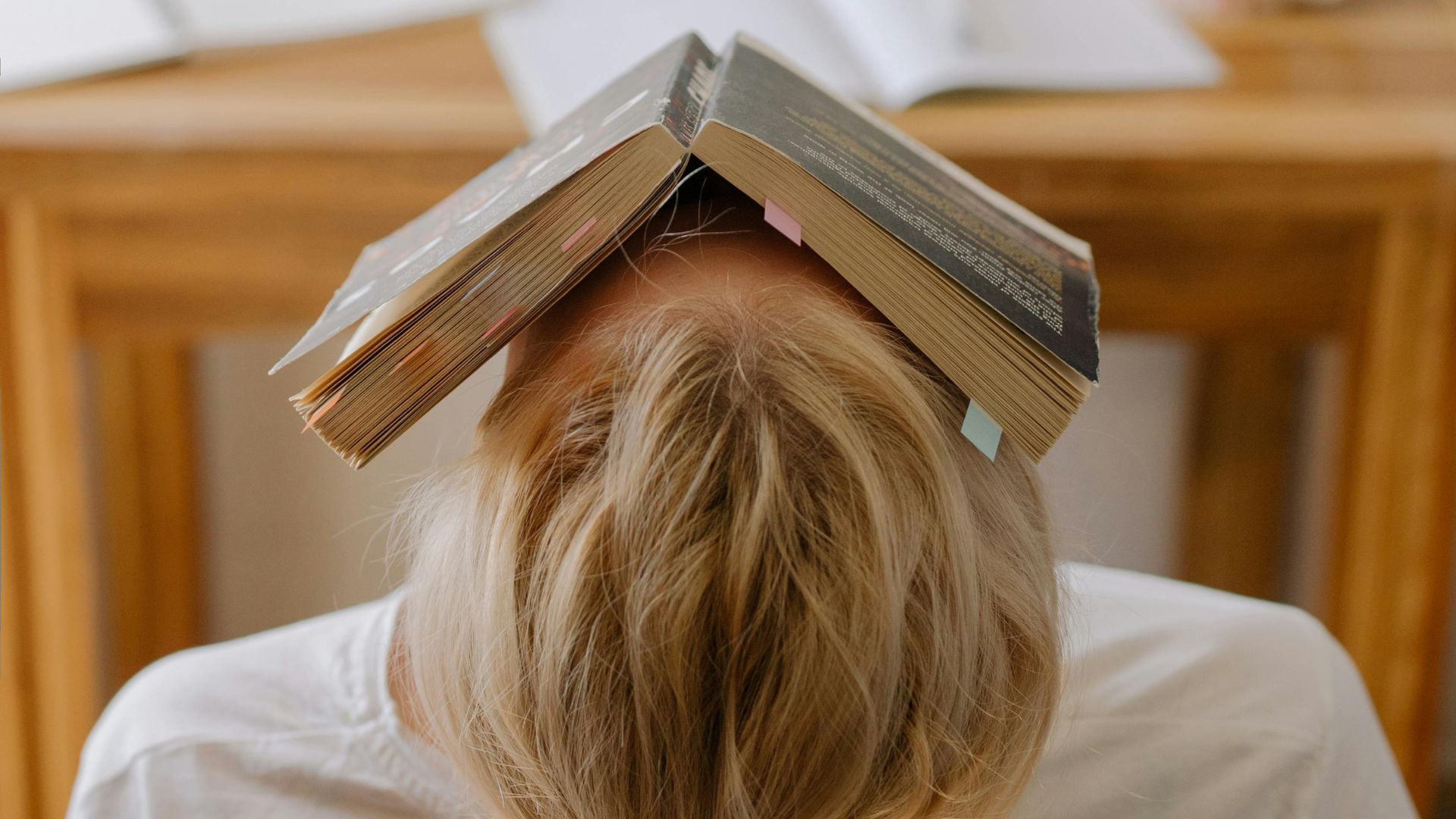
Fanfiction: Wenn Leser:innen zu Autor:innen werden – und Geschichten neue Wege gehen
Was Fanfiction über unsere Gesellschaft verrät: Wie Fans bekannte Welten neu erzählen – und warum das weit mehr ist als bloße Spielerei.
© pexels/ cottonbro
Ob Harry Potter mit Draco Malfoy durchbrennt, Daenerys in Game of Thrones nicht zur „Mad Queen“ wird – oder Bella sich für Jacob entscheidet: In der Welt der Fanfiction ist (fast) alles möglich. Millionen Menschen schreiben Geschichten zu ihren Lieblingsserien, Filmen oder Büchern, entwerfen komplett neue Figuren oder erzählen einfach alternative Enden. Was früher vor allem in Foren und auf Plattformen wie „FanFiktion.de“, „Archive of your Own“ (AO3) oder „Wattpad“ passierte, schafft inzwischen sogar den Sprung in den Buchhandel – Verlage veröffentlichen zunehmend Romane, die einst als Fanfiction begannen.
Was wäre wenn?
Was für viele nach bloßer Spielerei klingt, ist für andere weit mehr: Fanfiction ist ein Ort für Fantasie, Gemeinschaft und Selbstermächtigung. Sie bietet Schreibenden die Möglichkeit, eigene Perspektiven sichtbar zu machen, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen oder persönliche Erfahrungen zu verarbeiten. Und das oft in Welten, die sie schon lange begleiten. Die Kulturwissenschaftlerin Marion Näser-Lather erforscht Fanfiction seit vielen Jahren. Im Interview erklärt sie, warum gerade das Umschreiben von bekannten Geschichten subversiv sein kann, was Fanfiction über unsere Gesellschaft verrät – und warum sie endlich ernst genommen werden sollte.

Was war Ihr erster Berührungspunkt mit Fanfiction – und was hat Sie dazu bewegt, sich wissenschaftlich damit zu beschäftigen?
Marion Näser-Lather: Auf Fanfiction bin ich zum ersten Mal gestoßen als Star-Trek-Fan, Anfang der 2000er. Ich hatte im Netz danach gesucht, was andere Fans über die Beziehung zwischen Q und Picard denken – zwei Hauptcharaktere der Serie „Star Trek: The Next Generation“. So bin ich auf eine Fülle von Geschichten gestoßen, die genau diese Beziehung thematisierten. Im weiteren Verlauf wurde mir bewusst, dass es zu fast jeder bekannteren Serie, zu Filmen, Literatur, Computerspielen – ja sogar zu realen Prominenten – Fanfiction gibt.
Die Idee, mich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, steht im Zusammenhang mit einem Schwerpunkt in der Empirischen Kulturwissenschaft: der Erzählforschung. Uns interessiert, woher Geschichten kommen, wie sie sich verändern, warum sie erzählt werden, was sie für Menschen bedeuten – und wie sich Gemeinschaften um Formen des Neu- und Umerzählens von Medienerzeugnissen bilden. Besonders mit diesem letzten Punkt habe ich mich beschäftigt.
Was macht es für viele so reizvoll, bekannte Welten wie Harry Potter oder Game of Thrones weiterzudenken oder neu zu erzählen?
Fanfiction ist eine ermächtigende und kreative Aneignung sowie Neudeutung des Originalstoffs. Medienkonsument:innen werden zu aktiven Mitbestimmer:innen über die Ausgestaltung der fiktiven Welt – das deutet auch der Titel der FanFiction-Plattform „Archive of Our Own“ an. Oft wird der latente Subtext – also das, was mitschwingt – von Fans ausgestaltet. Besonders das, was in der kommerziellen Massenkultur marginalisiert oder tabuisiert wird, findet hier Platz.
Fanfiction kann also auch aus Unzufriedenheit mit dem Canon entstehen – etwa, wenn Fans die letzte Staffel von Game of Thrones umschreiben, weil sie Entwicklungen als unerwünscht empfinden. Darüber hinaus füllt Fanfiction Lücken im Original, erklärt Widersprüche oder spinnt Offenes weiter – und bietet Raum für das Spiel mit Charakteren oder schriftstellerische Herausforderungen.
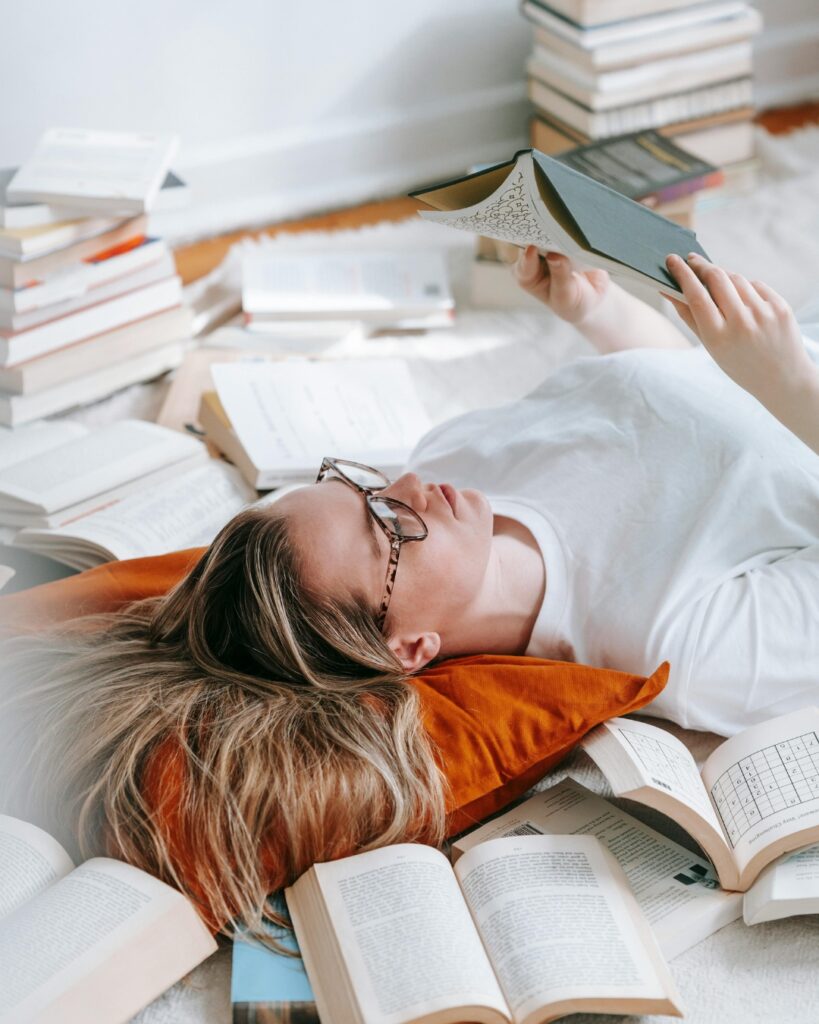
Welche typischen Erzählmuster begegnen einem dabei besonders häufig – und was sagt das über die Bedürfnisse der Schreibenden aus?
Fanfiction tritt in sämtlichen Genres auf, wie romantische Erzählung, Tragödie, Komödie oder Held:innenreise. Einige Formen sind besonders typisch, etwa „Plot-What-Plot“-Texte mit Fokus auf erotische Szenen, „Alternate Universe“-Stories, in denen Charaktere in andere Settings versetzt werden, oder Crossovers, in denen verschiedene fiktionale Welten aufeinandertreffen.
Spannend sind auch sogenannte Self-Inserts: Hier schreiben sich Autor:innen selbst in die Geschichte. Diese Texte zeigen den Wunsch nach Nähe, Identifikation und Sehnsucht. Manch mal geraten solche Fanfictions allerdings wegen überzogener Selbstdarstellung in Verruf.
Fanfiction ist für viele ein niedrigschwelliger Einstieg ins Schreiben. Welche Funktion erfüllt sie als kreativer Übungsraum für angehende Autor:innen?
Der Einstieg ist niedrigschwellig, weil Universum und Figuren bereits vorgegeben sind. Gleichzeitig ist es anspruchsvoll – denn um Fanfiction „richtig“ zu schreiben, braucht es fundiertes Wissen über das Original. Die Geschichten sollen plausibel im Canon verankert sein – es sei denn, Abweichungen sind bewusst gesetzt.
Fanfiction-Autor:innen profitieren außerdem stark vom Feedback: Nicht nur durch Likes, sondern auch durch Rezensionen oder Unterstützung durch Beta-Reader:innen und Reviewer:innen – teils auf hohem schriftstellerischem Niveau.
Fanfiction wird oft als ‚Mädchenkram‘ belächelt – dabei ist das Umschreiben von Geschichten eine uralte kulturelle Praxis.
Marion Näser-Lather, Kulturwissenschaftlerin

In vielen Erzählungen lassen sich persönliche Erfahrungen oder sensible Themen erkennen – wie Queerness, Trauma oder psychische Erkrankungen. Inwiefern bietet Fanfiction Raum für die Auseinandersetzung mit eigenen Emotionen oder Identitätsfragen?
Der Schreibprozess bringt die Möglichkeit zur Distanzierung und Verfremdung – also dazu, eigene Erlebnisse in ein fiktives Universum zu übertragen. So lassen sich auch schmerzhafte oder belastende Themen ausdrücken, ohne sie direkt zu benennen. Manche Autor:innen erzählen traumatische Erlebnisse mit besserem Ausgang neu – eine Verarbeitungsform, die auch in der Traumatherapie Anwendung findet. Das kann eine kathartische Wirkung haben. Oder wie es auf fanfiction.net früher hieß: „Unleash your imagination and free your soul.“
Welche Rolle spielen Communitys in der Rezeption und Produktion von Fanfiction?
Communitys sind nicht nur Orte des Austauschs und der Bestätigung, sondern auch Räume für Inspiration. Man diskutiert unterschiedliche Figuren oder Handlungsverläufe, vergleicht Film- und Buchversionen, schreibt gemeinsam Geschichten oder ruft Challenges aus. Gleichzeitig übernehmen diese Foren auch Regulationsfunktionen: Sie bewerten Qualität, ordnen Inhalte nach Jugendschutzsystemen und löschen Texte, die gegen Richtlinien verstoßen.
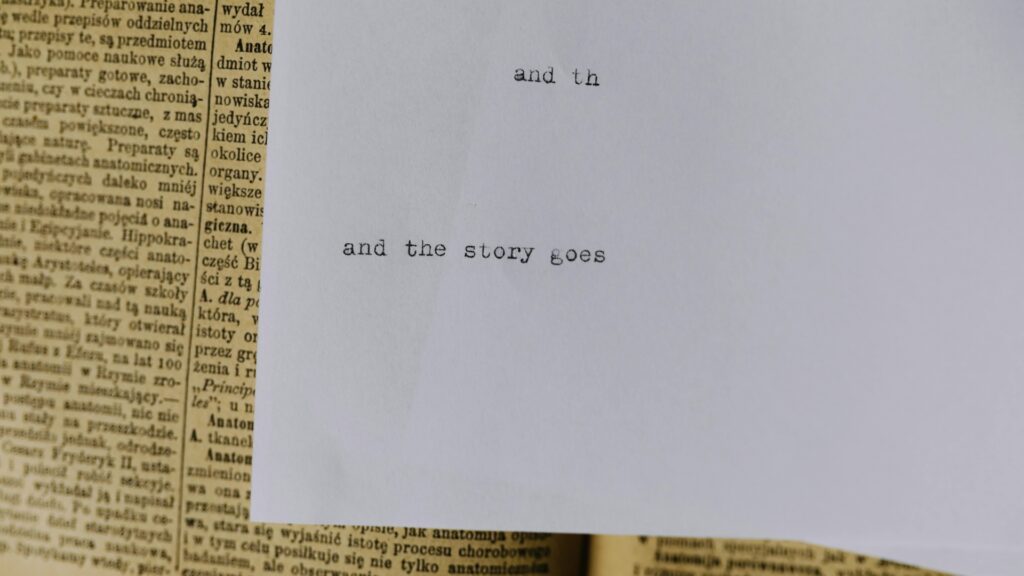
Trotz Millionen von Leser:innen geben viele jedoch nicht gern zu, Fanfiction zu schreiben oder zu lesen. Warum ist das Genre gesellschaftlich noch immer so wenig anerkannt?
Fanfiction wird oft als naiver, romantischer „Mädchenkram“ abgewertet. Das hängt mit der Tabuisierung erotischer Inhalte zusammen und mit der Vorstellung vom literarischen „Genie“, das oft männlich konnotiert und auf Originalität fixiert ist. Dabei ist die Neu- und Umerzählung kulturell uralt: Mythen, Märchen, Theaterstücke wurden schon immer neu erzählt. Der moderne Originalitätsanspruch ist ein bürgerliches Konzept der letzten Jahrhunderte.
Mit digitalen Technologien wurde das aktive Mitgestalten leichter – aber die Anerkennung hinkt hinterher. Dabei kann Fanfiction auch hochkomplex sein, man denke nur an Fifty Shades of Grey, das ursprünglich Twilight-Fanfiction war.
Gibt es Trends oder Entwicklungen, die das Schreiben oder Lesen von Fanfiction aktuell besonders prägen?
Es gibt eine zunehmende Vielfalt: Fandoms, Genres und Erzählformen differenzieren sich weiter aus. Auch sprachlich wird es internationaler – Englisch dominiert beispielsweise nicht mehr überall. Zudem verändern technische Studio Tools wie KI-Generatoren oder Plattformen wie Veo 3 die Fanfiction-Szene: Fanfilme, interaktive Formate und KI-unterstütztes Schreiben, beispielsweise mit ChatGPT, öffnen neue Möglichkeiten und kreative Wege.
Was wünschen Sie sich für den wissenschaftlichen oder öffentlichen Umgang mit Fanfiction in Zukunft?
Ich wünsche mir eine Abkehr vom normativen Kulturbegriff, der „Hochkultur“ und vermeintlichen „Trash“ trennt. Fanfiction ist Teil der Alltagskultur – und oft Kunstform, Ausdrucksform, Spiel mit Text. Sie verdient mehr Akzeptanz – nicht trotz, sondern wegen ihrer Offenheit, Vielfalt und gesellschaftlichen Relevanz.
Das könnte dich auch interessieren
- What to watch: Filme und Serien im Herbst
- Wie Musikgenres unsere Stimmung und unser Verhalten beeinflussen
Mehr zur Autorin dieses Beitrags:

Tjara-Marie Boine ist Redakteurin für die Ressorts Business, Leben und Kultur. Ihr Herz schlägt für Katzen, Kaffee und Kuchen. Sie ist ein echter Bücherwurm und die erste Ansprechpartnerin im Team, wenn es um Themen wie Feminismus und Gleichberechtigung geht.
Weitere Artikel zu diesem Thema
Lifestyle
3 Min.
Vorab ausgezeichnet: Die Top 10 Weine der Weinmesse Innsbruck 2026
Qualität, die überzeugt – schon vor dem ersten Messetag.
Noch bevor die Weinmesse Innsbruck 2026 ihre Tore öffnet, rückt ein besonderes Highlight in den Fokus: die exklusive Blindverkostung der eingereichten Spitzenweine, die am 7. Februar 2026 stattgefunden hat. Ausgewählte Weine der ausstellenden Winzer:innen wurden dabei von einer hochkarätig besetzten Fachjury blind verkostet und objektiv bewertet. Die Jury setzte sich aus renommierten Vertreter:innen aus Sommellerie, Gastronomie, Hotellerie und Medien zusammen – … Continued
3 Min.
Lifestyle
3 Min.
Weinmesse Innsbruck 2026 – das Genusserlebnis des Jahres
Die Weinmesse Innsbruck 2026 lädt zum Genusserlebnis der Extraklasse
Vom 26. bis 28. Februar 2026 verwandelt sich die Messe Innsbruck bereits zum 24. Mal in einen Treffpunkt für alle, die Wein, Genuss und persönliche Begegnungen lieben. Die Weinmesse Innsbruck ist mehr als eine Messe – sie ist ein Fest für die Sinne. Rund 140 Aussteller:innen aus 7 Nationen präsentieren etwa 1.300 erlesene Weine, Schaumweine und … Continued
3 Min.
Mehr zu Lifestyle